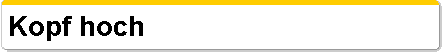|
Sie nahm ihren Rucksack, ein paar warme Sachen, Zahnbürste, Kamm, zog ihre Bergschuhe an, Mütze, Handschuhe und steckte ihre Schmerztabletten ein, soviel, wie da war. Maria wusste nicht, für wie lange sie reichen mussten, es war auch eigentlich egal. Leicht mulmig war ihr schon, doch die Entscheidung war gefallen, die Konsequenzen wollte sie tragen, jetzt zumindest. Vertrauen war gefragt, sonst brauchte sie gar nicht losgehen. Erzwungenes Vertrauen, ja sicher, Eine Wahl hatte sie ja kaum, höchstens zwischen einer Sackasse und einem Abgrund. Alles zurücklassen, ja das fiel schon schwer. Ein sehnsüchtiger Blick zurück auf ihr Bett, so warm und weich, die Versuchung war groß, sich einfach hinzulegen, zuzudröhnen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, haha blöder Witz. Schon komisch, wo sie doch immer das Meer so geliebt hat, sich jetzt auf in die Berge zu machen. Aber das Meer hatte es ja nicht gebracht und das Gefühl hoch oben einfach schon geografisch etwas über allem zu stehen, das vermittelte Zuversicht. Das ist wohl der Traum vom Heidi sein. Auf in die Berge und alles wird gut, bloß dass sie wohl nicht so fröhlich über die Steinchen hüpfen wird, außer vielleicht, in ferner Zukunft.
Tja und Mann und Kind? Darüber denkt sie jetzt nicht nach. Das kommt schon noch später. Es wird schon gehen, mit den beiden. Außerdem widerlegt sie jetzt den Satz: 'Ja die Maria, die denkt immer zuerst an andere'. Das ist sowieso Quatsch, sie denkt immer zuerst an ihre Angst, an das, wie es aus dem Wald zu ihr zurückschallt, wenn sie hineinruft.
So und jetzt mein Herz, mach dich auf und fliege, das kleine Wikingermännchen fiebert schon und hält dein Seelchen kaum noch gut und warm.
Es ist kalt.
Die erste dünne Eisschicht bildet sich auf Wasserlachen und Gartenteichen. Vielleicht kommt ja einmal wieder ein richtiger Winter, einer mit viel schönem, weichen Schnee, viel Sonne und viel Eis. Mit Bedauern denkt Maria an ihre neue Langlaufausrüstung, die im Keller steht und vielleicht nie von ihr benutzt wird. Das rechte Bein zieht sie ja schon ein wenig nach. Einfach loslaufen, ja das gehört der Vergangenheit an, dabei ist sie immer gern und viel gegangen. Gut, nicht direkt gewandert, das waren Pläne, nach dem Motto, später, wenn ich mal mehr Zeit hab, dann geh ich viel wandern. Gute Schuhe hat sie dafür immer gehabt und in der Phantasie ist sie auch schon so manche Tour gegangen. Das war auch schon ganz nett, in gewisser Hinsicht sogar netter als real, die Füße taten nämlich nicht weh und außerdem begegnen einem in der Phantasie keine bissigen Hunde und man wird nicht nass bei Regen, das ist schon praktisch. Schluss mit zynisch. Nun wo Maria wirklich loszieht ist es schon einfach so ein Kampf, gegen die schmerzende Hüfte, tja jetzt gibt es eben kein Zögern mehr. Die Aussicht auf klare Bergluft, Stille in der Natur und Reinigung, tiefe Reinigung, die treibt.
Erst kommt allerdings die Bahn. Am Bahnhof, Menschen, große, kleine, alte, junge, sie bleiben ihr seltsam gleichgültig, obwohl sie die Wartezeit damit verbringt, sie zu betrachten. Eigentlich interessiert es sie nicht mehr sonderlich. Ein leichtes Erstaunen, darüber, dass es überall Menschen gibt, die ganz unauffällig ihren Dingen nachzugehen scheinen, obwohl Maria sich gerade aufmacht, das Universum zu ergründen, wenn auch nur ihr eigenes. All diese Leute machen ihre eigene Dramatik, ihre eigene Welt so klein. Sie wird unwillig, all das will sie gar nicht mehr wissen, dass es noch ein Leben gibt wie früher und dass es das für all die anderen noch beinahe ewig so geben wird. Sie wird fast wütend, schon wieder nagt es an ihr, all diese Gedanken, die sie doch alle gar nicht mehr will, zurücklassen will, die Wut, der Neid auf andere, die, das weiß sie sicher, plötzlich und unerwartet auf sie selbst zurückfallen. So ist es immer schon gewesen, alles, was sie austeilt, holt sie wieder ein, sie holt es sich selbst zurück und wendet es gegen sich selbst.
Puh, Ablenkung tut Not, noch darf das sein, hier auf dem Bahnhof in der kalten Stadt, die so lange Heimat war, die sie immer mal wieder verlassen wollte und die ihr doch ans Herz gewachsen ist, ein wenig aus Mitleid, sie kann ja nichts dafür diese Stadt.
Außerdem beherbergt sie ihre Lieben, die einzigen beiden, die sie hat und noch ein paar vertraute Gute, die ihr gut sind. Ob es ein zurück gibt? Vielleicht nie, vielleicht nur ein kurzes, wenn mich mein Weg woanders hinzwingt, wie in Casablanca, sie lieben sich, aber sie müssen sich trennen und keiner zweifelt daran. Gibt es das? Ach sie weiß es nicht, noch nicht, aber sie will es wissen. Ist das, was kommt, eine Phase? Kommt danach noch etwas anderes, oder ist dann Schluss oder dauert die Phase? Gut ist es, wenn all das nicht mehr interessant ist, auch darum geht sie, das überwinden, die Gedanken überwinden, Pläne, Absichten, auch geheime, die sie kaum sich selbst verrät. All das stört den Kompass, der funktioniert dann nämlich nicht mehr und was soll sie sich in den Bergen verirren.
Erfrieren soll ja ein schöner Tod sein. Das behauptete immer ihr Kunstlehrer. Während sie über Äpfel und Birnen gebeugt und verzweifelt versucht, ihnen auf dem Papier eine Rundung zu geben, erzählt er von Norwegen, Nordnorwegen und dass ihm dort einmal ganz warm wurde vor Kälte und er eigentlich nichts dagegen gehabt hätte, dort im Eis zu bleiben. Seine Augen leuchteten ein wenig und für kurze Zeit sah er sie wohl vor sich, die Weite des Eises. Was zarte Schülerherzen daraus fürs Leben lernen sollten, das war ihr ein Rätsel. Doch dann kehrte er zurück, in den Kunstraum des Gymnasiums, zu uns, lauter unbegabten Biestern, zu Apfel und Birne auf dem Tellerchen. Ich glaube, in diesem Kunstraum leuchtete nicht eine einzige Farbe zu Herrn Wutkes Zeiten und ich glaube auch nicht, dass je der Name eines Künstlers fiel. Lange Zeit wusste Maria überhaupt nicht, dass es einen Unterschied gab, zwischen Maler Meier, der bei ihr zu Haus die Wände weißte und Maler Dürer, von dem die betenden Hände über ihrem Bett stammten. Sie dachte, Meier würde das wohl auch gelernt haben. Kunst und Kirche, ja da gab es eine Verbindung. Der Kreuzweg, das Leiden Jesu auf Leinwand gebannt, das begriff sie nicht als Kunst, nein das waren die Schrecken des Lebens, aber die schönen bunten Kirchenfenster...
Im Zug, ein guter Platz, es ist keine Hauptverkehrszeit, keiner kommt ihr zu nah. Vom Fensterplatz ein letzter Blick auf Häuser, Bäume und Plätze. Es krampft sich doch ganz schön, das Herz. Jetzt schon überfällt sie heftiges Heimweh, Sehnsucht nach dem Kinde, dem Süßen. Gut, dass einmal gefasste Beschlüsse auch zum Daranfesthalten da sind. Außerdem ist da ja auch noch die Opfertheorie.
Wachstum erfordert Opfer. In jedem Leben gilt es die Stellen zu erkennen , an denen Opfer vonnöten sind. Opfern wir nicht, werden wir geopfert. Kann sein, die Idee ist von Jung.
Maria wollte nie opfern, niemals freiwillig, doch jetzt in ihrer Lage geht es plötzlich ganz schnell. Nur nicht zu lange darüber nachdenken und ja nicht darüber sprechen. Die Konsequenzen kann sie ja dann tragen, wenn sie zu tragen sind.
Der Zug ist losgefahren. Sofort bekommt Maria Hunger. So war das immer schon. Zum Zugfahren gehören eingepackte Butterbrote, Obst, Saft und Frauenzeitschriften, die mit den vielen Tipps vom Schönerwohnen, Schöneressen, Schönerlieben. Bis der Zug am Rhein ist und sich das hinaussehen lohnt, wegen der vielen Burgen, dauert es ja noch etwas.
Ab Dortmund wird sie wieder melancholisch. Onkel Hermann fällt ihr ein, die Familienausflüge in die große Stadt am Rhein, die vor allem den einen Fehler hatte, nicht Köln zu sein. Die erste große Stadt ihres Lebens, die ersten Straßenbahnen und Hochhäuser. Und doch die Liebe zu ihrem Onkel Hermann machte sie solidarisch. Diese Stadt blieb blass, nur Köln zählte und dort der Dom. Seine Kindheit dort muss furchtbar gewesen sein, vielleicht hängte er darum sein ganzes Glück an dieses Bauwerk. Er schaffte es auch, in ihr eine fast unerklärliche Zuneigung zu Köln zu wecken, obwohl sie doch sonst zutiefst norddeutsch unterkühlt war. Der einzige Mensch, den sie kannte, der sein Herz unveränderlich an etwas gehängt hatte und das machte ihn so liebenswert, dabei war er objektiv betrachtet ein totaler Versager, vielleicht gar ein Kinderschänder und sicher ein Selbstmörder.
Enden eigentlich alle Geschichten Marias so negativ, so hoffnungslos?
Sie will ins Licht und das erscheint zunächst als rheinische Sonne, die kalt und weiß, aber hell den Zug Richtung Süden begleitet.
Woher weiß Maria eigentlich, wo sie hin muss und ob sie dort auch willkommen ist. Ein Name, eine Adresse, aus dem Frauenselbstfindungsinformationssumpf, der hängen geblieben ist, und zwar woanders als im Hirn. Ein Name, der auf einen Traum traf, den Traum von Wärme, Weisheit, Heilung, Läuterung, Kräutertees und nach Hause kommen. Und die Idee ist bestechend einfach, vielleicht zu einfach für die Wirklichkeit, aber einen Versuch wert. Und so wie sie nun in den Genuss dieser Einrichtung kommen möchte, so kann sie sich zugleich vorstellen, selbst einmal das zu geben. Nun das ist schon etwas vermessen, denn zu geben hat sie eigentlich nichts zur Zeit, es ist wohl eher Zeit zu nehmen.
Sie hat es nicht verstanden, das ist eigentlich ganz einfach. Sie hat nicht verstanden, dass alles nur ein Spiel ist, ein Spiel auf Zeit. Wenn wir alle einem Atom entspringen, dass sich einfach nur aus Zufall durch einen Energieimpuls ausgedehnt hat und noch ausdehnt, wenn wir alle doch nur immer weiter auseinanderdriften und uns verlieren müssen, wenn wir vielleicht auch alle wieder auf die Größe eines Atoms zusammenschrumpfen, dann gibt es wahrlich keinen Grund, diesen Flohschiss ernst zu nehmen. Alle Denker, alle Wissenden, alle Weisen der Welt, sie spielen und sie schaut ehrfürchtig zu ihnen auf, und lässt zu, dass sie sich in die Mitte ihrer Welt stellen. Erschaffe sie sich doch ihr Universum und stelle sich in die Mitte und spiele das Spiel.
Ach, an manchen Tagen ist ihr die Welt zu nah und sie möchte sie gern von sich schieben, doch dann macht diese mit ihr was sie will und vor allem nimmt sie ihr den Mut. Dann versucht sie an die Berge zu denken. Die weißen Zacken über grünem Wald und grauen Felsen, die den Blick aufwärts zwingen, führen zu jenen Herzenskrämpfen, die direkt das Wasser in die Augen treiben, überschüssige Luft aus den Lungen ziehen und die Sehnsucht wecken.
Warum schämt sie sich nur dieser Regungen? Ohne diesen Herzenswunsch hätte sie ja gar nicht losfahren brauchen und ist es nicht gleich, ob die Hoffnung durch Klaras erste Schritte aus dem Rollstuhl geweckt wurden oder durch Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer.
Und wenn es das Panorama einer Fototapete ist, das ein Herz ins Fließen bringt, es führt doch direkt zu jedes Wesens ureigener Erfahrung mit Natur, einer homöopathischen Erfrischungsdosis gleichsam.
Maria wacht auf und sitzt im Zug, der Schaffner will die Karte stempeln.
Jedes Mal, aber auch wirklich jedes Mal, wenn sie einen Schaffner sieht, steigt Panik in Maria auf, sie könne ihre Karte nicht finden. Die Hände werden sofort schweißnass. Direkt nachdem sie ihre Karten gekauft hat, kommt es manchmal vor, dass sie, während sie mit der Angst vor Kartenverlust beschäftigt ist, sie diese zusammenrollt, ja rollt, wie eine selbstgedrehte Zigarette und unbewusst in irgendeine Tasche steckt. Wenn sie wieder wach wird, kommt ein kurzes Erschrecken, hektisches Suchen, meistens Finden und dann, Entsetzen darüber, wie verwirrt sie ist.
Aber sie hat einen Verdacht, wenn sie nämlich später im Zug ihre Mitreisenden betrachtet, glaubt sie, auch bei jedem von ihnen dieselben Symptome feststellen zu können.
Einige halten ihre Karten die ganze Zeit in der Hand und sobald der Schaffner in Sichtweite kommt, zuckt diese ein ganz wenig krampfhaft zusammen.
Andere kramen in ihren diversen Taschen herum, wobei ihr Gesicht leicht rot anläuft. Auch die, vor allem Männer, die lässig die Brieftasche zücken, wirken so, als hätten sie dies zu Hause heimlich geübt, um Peinlichkeiten vorzubeugen und sich keine Blöße geben zu müssen. Da braucht es dann eine ganze Menge Hirnzellen, die beim Anblick einer Fahrkarte und eines Schaffners direkt auf Brieftasche programmiert sind.
Am schlimmsten sind Frauen mit Handtaschen. Die können in Maria extreme Aggressionen hervorrufen, so weit, dass sie schon überlegt hat, sich selbst eine Handtasche zuzulegen und dort ihre Fahrkarten zu verstecken damit sie dann die Aggressionen beherrschen lernt, quasi im Selbstversuch. Keine behandtaschte Frau schafft es, an ihrer Handtasche auf Anhieb das richtige Fach zu öffnen. Am schlimmsten sind die, die erst aus ihrer Reisetasche eine Handtasche und aus dieser ein Portemonnaie und dann aus diesem die Fahrkarten heraussuchen müssen. Damit einher geht eine ungeheure Belästigung. Vor den Fahrkarten kommt nämlich noch allerhand anderes zum Vorschein, mit dem sie sich als Mitreisende konfrontiert sieht. Fotos zum Beispiel, von Kindern, Enkelkindern, Ehegatten, Kreditkarten, abgelaufene Fahrscheine, Erfrischungstücher, Medikamente, Behindertenausweise. Keine Zeitung ist groß genug um sich vor solcher Mitteilungswut zu retten.
Der Schaffner geht und allmählich kehrt wieder Ruhe ein im Waggon. Am Bahnhof Köln angekommen würde sie am liebsten hinausspringen aus dem Zug und sich ins volle städtische Leben stürzen. Dom, Museen, Hinterhöfe mit römischen Mauerresten, Theater, Cafés, Buchläden. Die Aussicht, nach einem ausgiebigen Museumsbesuch, bei Cappuccino und Zigarette in neuerstandenen Büchern zu blättern ist schon sehr verführerisch, doch hier und heute sind das nur Ausweichmanöver, die sie langsamer zum Ziel kommen lassen, auch wenn sie keine Garantie hat, dass sie jemals wieder nach Köln kommt, oder überhaupt nur in irgendeinem Café, frei von schlechtem Gewissen sich selbst gegenüber, eine Zigarette rauchen wird.
Also bleibt sie sitzen und versucht, sich dem Gefühl des weiterfahrenden Zuges hinzugeben und sich empfänglich zu machen dafür, dass es im fahrenden Zug ja immer vorwärts geht und das ihr nichts passieren kann, solange das der Fall ist.
Langsam zuckelt der Zug den Rhein entlang und hinunter. Für Maria ist es hinunter, auch wenn es eigentlich hinauf ist. Von Norden kommend, nach Süden ist eben einfach hinunter, basta.
Am Rhein ist es schön, wie an jedem Fluss, doch er ist schöner, obwohl so geradegebogen, doch ein paar Kurven sind noch da und dann Wälder, Hügel, Täler und dieses schnuckelige Bonn, unser Zentrum der Macht, es sieht so herrlich harmlos aus. Das täuscht natürlich auch absichtlich.
Bald kommt Boppard und bei Boppard denkt Maria an Kirschen, die großen dicken dunklen süßen und wie sie ein einziges Mal in ihrem Leben einen Nachmittag unter einem Kirschbaum liegend verbrachte und sich die süßen Früchte verbotenerweise völlig ungehemmt schmecken ließ, in Boppard.
Im Blick zurück erscheint ihr diese Reise wie der Abschied von Kindheit, lauter Mädchen fünf Tage unterwegs mit Jugendpfarrer Heitmann. Wir Mädchen schon fast Frauen doch noch ziemlich unbekümmert, nur der wache Blick des Pfarrers, vielleicht auch etwas lüstern, ließ Ahnungen aufsteigen. Doch hurtig wischten die Mädchen diese Ahnungen weg, nur Augenblicke des Zögerns. Die restliche Zeit hatten wir gut Kirschen essen, durchwanderten Wälder und Weinberge.
|